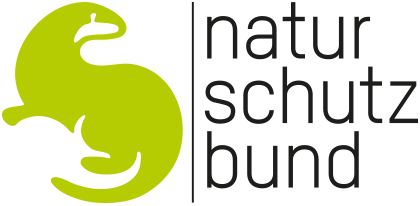Ein sekundärer Lebensraum ist ein stark vom Menschen verändertes Biotop, welches oftmals in Folge von Industrialisierung und wirtschaftlicher Erschließung eines Gebiets entstanden ist. Da diese Habitate zumeist unzugänglich, keinerlei Eingriffen unterworfen und störungsfrei sind, haben sie in einer Landschaft, der die Primärhabitate fehlen, ein großes ökologisches Potential.
Im Tullnerfeld gibt es verschiedene sekundäre Lebensräume, wie die großen Baumschulen und Gärtnereien rund um die Stadt Tulln, die Absetzbecken der Zuckerfabrik Tulln, das Industriegelände und die umliegenden Flächen des Kohlekraftwerks Dürnrohr, die großen Wiesenbereiche am Militärflugfeld Langenlebarn, die Ausgleichsflächen der Hochleistungsbahnstrecke der ÖBB sowie einige Schottergruben und Schlammbecken, vor allem nördlich der Donau. Diese Biotope stellen weitere inselartige und potentiell nutzbare Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt des Tullnerfeldes dar und haben sich zum Teil bereits als „Hotspots“ der Biodiversität in der Region etabliert.
„Biodiversitäts-Hotspot“ Kraftwerk Dürnrohr
Mit gezielten Managementmaßnahmen können in sekundären Lebensräumen artenreiche Ökosysteme entstehen, deren Fortbestand unbedingt erhalten, geschützt und gefördert werden sollte. Zu den ökologisch besonders bedeutsamen Sekundärstandorten des Tullnerfeldes zählen die artenreichen und vielseitigen Flächen des Kraftwerks Dürnrohr, welche als Schmelztiegel für verschiedene Lebensraumtypen und Arten fungieren. Die Nähe zu den Tullnerfelder Donau-Auen und der Perschling sind hier wohl gleichsam von Bedeutung wie die Topografie und die unterschiedlichen Nutzungsformen des Geländes.
Lebensraum Schottergrube
Auch Schottergruben, die sich im Abbau befinden oder bereits stillgelegt wurden, sind verteilt über das Tullnerfeld zu finden und haben ein großes naturschutzfachliches Potential. Ein hier zu findendes Kleinrelief an verschiedenen Habitaten ermöglicht eine hohe Biodiversität und bietet je nach Bewirtschaftungsintensität und Management wertvollen Lebensraum.
Positive Entwicklung entlang der Hochleistungsbahnstrecke (HLBS)
Im Zuge der Errichtung der HLBS der ÖBB wurden eine Vielzahl an ökologischen Ausgleichsflächen realisiert, die einerseits eine Vernetzung von Lebensräumen, in der sonst intensiv agrarwirtschaftlich genutzten Landschaft gewährleisten sollen, sowie zur Erhaltung von ökologischen Funktionen des Gebietes dienen. Beispiele hierfür sind Korridore für Wildtiere, Bruthabitate für Vögel und diverse Lebensräume für Insekten. Viele dieser ökologischen Ausgleichsflächen fügen sich aus kulturlandschaftlicher Sicht harmonisch in das Landschaftsbild des Tullnerfeldes ein.