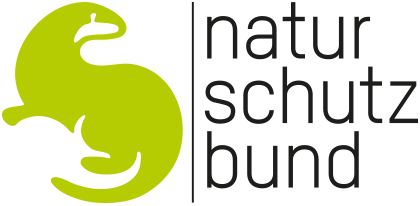Farbenfrohe Finken
Der Maikäfer
 Die Maikäfer zeigen sich in manchen Jahren in beeindruckender Menge. Nach mehrjähriger, unterirdischer Entwicklung führen sie ein kurzes, aber intensives Erwachsenenleben.
Die Maikäfer zeigen sich in manchen Jahren in beeindruckender Menge. Nach mehrjähriger, unterirdischer Entwicklung führen sie ein kurzes, aber intensives Erwachsenenleben.
Massenflüge wie in Königstetten 2021 sind mittlerweile selten geworden. Umso beeindruckender ist auch das tiefe fast statische Brummen, dass die Luft abends erfüllt, gemeinsam mit dem Rascheln der Blätter, Beine und Flügel.
1927, also vor fast 100 Jahren wurde im Atzenbrugger Gemeinderat noch eine Bonusprämie für das Sammeln von Maikäfern beschlossen und zwar insgesamt 10 Groschen pro Kilogramm Insekten – das entspräche derzeit in etwa 40 Cent.
Heutzutage liest man nicht mehr von Maikäferprämien, dafür umso mehr von Insektensterben und Biodiversitätsverlust – so ändern sich die Zeiten…
Insekten im Tullnerfeld
Der Waldmeister
 Mitten in der zentralen Agrarlandschaft des Tullnerfeldes findet man hie und da, in einem Windschutzgürtel versteckt, einen Waldmeister – Galium odoratum.
Mitten in der zentralen Agrarlandschaft des Tullnerfeldes findet man hie und da, in einem Windschutzgürtel versteckt, einen Waldmeister – Galium odoratum.
Der Waldmeister ist eigentlich ein typischer Bewohner des Wienerwaldes. Die entfernt mit dem Kaffee verwandte Pflanze aus der Familie der Rötegewächse verströmt einen charakteristischen Duft. Verantwortlich dafür ist der Inhaltsstoff Cumarin, der unter anderem in Zimt oder der Tonkabohne vorkommt. Daher eignet sich Waldmeister in Maßen, denn Cumarin kann in größerer Menge gesundheitsschädlich wirken, auch zum aromatisieren von Süßspeisen beziehungsweise mehr oder weniger alkoholischer Getränke.
Wie kommt der Waldmeister aber in den Windschutzgürtel? Die kleinen Klettfrüchte können sich im Fell von Reh, Hase, Fuchs & Co verhaken und so weit verbreitet werden.
Der Schlehdorn
Der Reiherschnabel

Der Reiherschnabel hat es gerne trocken und sonnig. Zartrosa blüht er bereits zeitig im Frühjahr, auch im Tullnerfeld gerne an Acker- und Wegrändern oder auf Brachflächen.
Besonders bemerkenswert sind allerdings seine Samen: ein langes Anhängsel dreht sich bei Austrocknung schraubenzieherartig ein, nur um sich bei feuchterem Wetter wieder auszurollen. Dadurch können sich die Samen buchstäblich in den Boden bohren.
Ob dieser ausgeklügelte Mechanismus bei der fortschreitenden Bodenversiegelung noch hilft ist fraglich – Zeit für die Evolution Richtung „Schlagbohrersamen“!
Das Hungerblümchen

Live fast, love hard, die young! – So lautet das Lebensmotto des Hungerblümchens. Nicht länger als ein paar Monate durchlebt dieses unscheinbare Pflänzchen von der Keimung bis zur Frucht.
Winzig und ressourcenschonend steht das Hungerblümchen im Leben – meist an sonnigen, trockenen Standorten ohne viel Konkurrenz, egal ob im wertvollen Trockenrasen oder am Bahnsteig.
Bereits im März in Vollblüte entwickeln sich die Früchte rasch. Im Sommer ist nichts mehr zu sehen, nur die Samen liegen unbeachtet in der Landschaft, bereit zu keimen.
Der Huflattich
 Ein kräftiges Gelb in so mancher blumenlosen Landschaft zeigt sich, wenn der Huflattich blüht. Im Frühjahr sind die eindrucksvollen Blüten an Straßenrändern und Bahndämmen ein willkommener Farbtupfer, der das Ende der kalten Jahreszeit ankündigt.
Ein kräftiges Gelb in so mancher blumenlosen Landschaft zeigt sich, wenn der Huflattich blüht. Im Frühjahr sind die eindrucksvollen Blüten an Straßenrändern und Bahndämmen ein willkommener Farbtupfer, der das Ende der kalten Jahreszeit ankündigt.
Anspruchsvoll ist er dabei nicht, der Huflattich. Er wächst, wo sonst nur wenig wächst und blüht, wenn sonst nur wenig blüht. Seine riesigen Blätter erscheinen erst im Sommer wenn die löwenzahnartigen Samen sich schon mit dem Wind verflüchtigt haben.
Eine resiliente Pflanze, die die Landschaft auch in Zeiten der Bodenversiegelung noch farbenfroh macht.