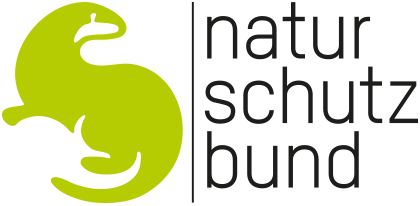Der Mauersegler (Apus apus) wird auf den ersten Blick gerne mit einer Schwalbe verwechselt, doch die dunkle Farbe, das sichelförmige Flugbild und die schrillen Rufe sind unverkennbar. Er ist ein wahrer Flugkünstler, der pro Jahr ca. 200 000 km zurücklegt. Sie fliegen nicht nur jährlich an die 20.000 km auf dem Zug, sondern verbringen mit Ausnahme der Brutzeit ihr ganzes Leben in der Luft und können sogar fliegend schlafen.
Ihr durchdringendes „srii srii“ ist ein Zeichen, dass der Sommer beginnt, da der Mauersegler erst im Mai in seinen Brutgebieten ankommt. Als ursprünglicher Bewohner von felsigen Wänden wohnt er in Österreich oft in Siedlungen und sogar Städten, wo sein Nest in Gebäudehohlräumen gebaut wird.
Mauersegler zählen zu den Langstreckenziehern, das bedeutet, dass sie den Winter südlich der Sahara verbringen. Diese anstrengende Reise beginnt oft schon Mitte Juli und ist stark von der Witterung abhängig. Da sich die Vögel ausschließlich von Insekten im Flug ernähren, ist es bei Schlechtwetter schwieriger, Nahrung zu finden und den nötigen Treibstoff aufzubauen.